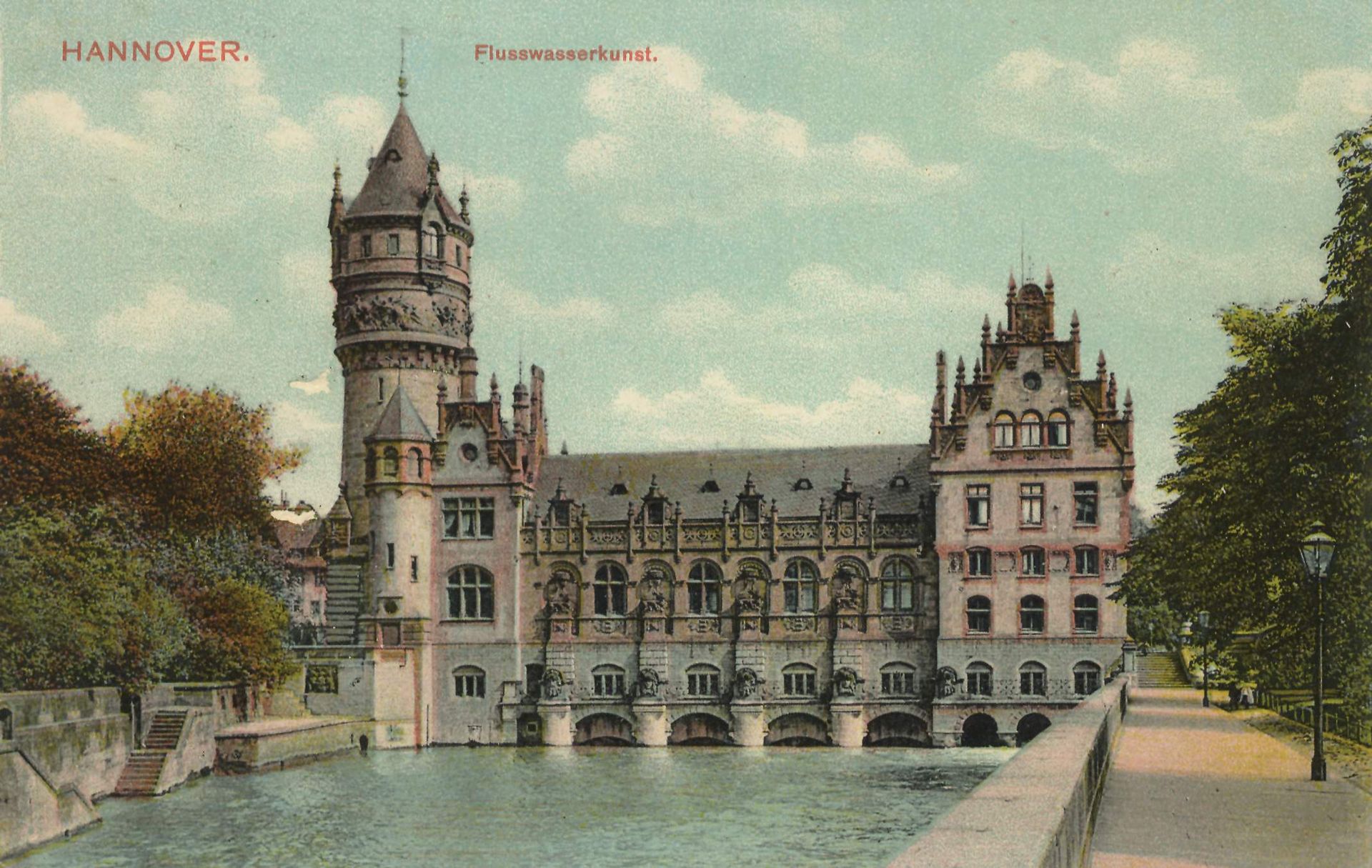Königinnendenkmal
Das Königinnendenkmal oder Prinzessinnen-Denkmal am Rand der Eilenriede in Hannover aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs Anfang des 20. Jahrhunderts stellt die beiden Prinzessinnen und späteren Königinnen Luise von Preußen und Friederike von Hannover dar. Luise und Friederike Beide wurden in Hannover im Alten Palais gegenüber dem Leineschloss als Töchter des späteren Herzogs von Mecklenburg-Strelitz Karl II. geboren. Die Schwestern wurden durch ihre Doppelhochzeit mit Kronprinz Friedrich Wilhelm (1770–1840) und Prinz Friedrich Ludwig (1773–1796) im Jahr 1793 in Berlin zunächst Prinzessinnen von Preußen. Wenig später schuf der Bildhauer Johann Gottfried Schadow von 1795 bis 1797 für das Berliner Schloss die früher dort aufgestellte Prinzessinnengruppe. Diese Plastik ist heute ein Exponat in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Durch ihre dritte Ehe (ab 1815) mit Ernst August I. wurde Friederike 1837 Königin von Hannover. Das Königinnendenkmal Das Doppel-Standbild der sich aneinanderschmiegenden Königinnen wurde um etwa ein Drittel größer ausgeführt als das Original der im Berliner Schloss aufgestellten Prinzessinnengruppe. Das monumentale Ausmaß der Kopie der klassizistischen Figurengruppe hatte symbolisch-staatspropagandistische Funktion: Eine Königin von Preußen und die erste Königin …